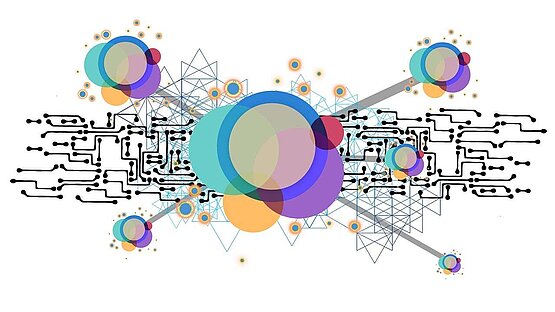Transformation ist mehr als eine rein strukturelle Veränderung und die Optimierung des Bestehenden. Neben allen organisatorischen Neuerungen und strukturellen Anpassungen soll sich vor allem die Kultur unserer Zusammenarbeit entwickeln, um
die Haltungen der Kirchenentwicklung in unserem Zusammenarbeiten erkennbar und erfahrbar zu machen.
- als Kirche zukunftsfähig und anschlussfähig zu sein.
- gemeinsam den Herausforderungen der Zeit zu begegnen.
In den vergangenen beiden Phasen des Transformationsprogramms sind als Grundlage für eine solche Veränderung die Haltungen der Kirchenentwicklung und die Leitlinien festgelegt worden. Sie bieten Orientierung auf dem Weg zu einer neuen Kultur.
Auf dieser Basis sind die Transformationsmarker (=Trafomarker) als praxisnahe und beobachtbare Kriterien für die Veränderung entstanden.
Wie arbeiten wir (zusammen)?
Die Transformationsmarker benennen konkret beobachtbare Merkmale für eine Kultur und für eine Kulturveränderung im Rahmen des Transformationsprogramms.
Sie leisten einen Beitrag, um
- Kultur erkennbar, beschreibbar und erfahrbar zu machen, z. B. dadurch, dass wir mit den Markern Begriffe und Kriterien haben, um die Kultur unseres Zusammenwirkens zu beschreiben, vielleicht sogar zu bewerten (Transformationsmarker „Beteiligung“: Einschätzung von 1 bis 10).
- zu reflektieren, wie wir arbeiten – und zusammenarbeiten, z. B. indem wir uns als regelmäßig, bspw. nach jeder Rücksprache, kurz austauschen, ob und wie wir von uns ausgewählte Marker in der Situation erlebt haben.
- Veränderungen überprüf- und nachvollziehbar zu machen, z. B. indem wir uns darüber austauschen, was sich, bezogen auf einzelne Marker, bei uns ggf. verändert hat.
- sich mit der bestehenden Kultur und deren Veränderung bewusst zu beschäftigen, bspw. indem wir uns die Zeit nehmen, miteinander zu reden, ob uns Veränderungen in unserem Zusammenwirken, die wir durch die Marker jetzt benennen können, gefallen oder missfallen und ob und wie wir damit arbeiten wollen.
Für Transformationsmarker sind erste konkrete Ausprägungen beschrieben, damit sie (in den einzelnen Prozessen) gut angewendet werden können. Sie sind mit der Kultur, die sie beschreiben, in steter Veränderung und offen für Ergänzungen.
Die Transformationsmarker
Wie soll mit den Transformationsmarkern gearbeitet werden?
Die Transformationsmarker können ganz unterschiedlich eingesetzt werden, z.B.:
- als Ausgangspunkt: Wie arbeiten wir eigentlich jetzt zusammen?
- als Veränderungs- oder Zielpunkt: Welcher Marker soll zukünftig die Zusammenarbeit prägen?
- als Beobachtungspunkt für uns: Wie weit prägt dieser Marker im Rahmen unserer Veränderung schon unsere Zusammenarbeit?
- als Resonanzpunkt für andere: Ist dieser Marker auch für andere in unserer Zusammenarbeit erkennbar?
Alle Transformationsmarker sind gleich wichtig. Die Ausgangspunkte in den verschiedenen Regionen und Bereichen sind sehr unterschiedlich. Deshalb besteht die Möglichkeit, einzelne Marker bewusst auszuwählen und vorrangig zu bearbeiten. Es muss nicht an allen Markern zugleich gearbeitet werden. Und je nach Prozessfortschritt in Ihrem Umfeld sind vielleicht auch schon einige Marker bereits umgesetzt.
Instrumente und Methoden zur Arbeit an den Transformationsmarkern
... werden hier laufend ergänzt.
AUF WELCHEN TRANSFORMATIONSMARKER ZAHLT DAS JEWEILIGE INSTRUMENT BESONDERS EIN?
- DOWNLOAD: Anwendungsfragen zu den Transformationsmarkern
- Beispiel für eine Online-Umfrage
- DOWNLOAD: Beobachtungskarten, als Anregung zu Feedback, bspw. nach Sitzungen
- Viele Informationen zum Mitarbeitendengespräch: ein Leitfaden, Formulare, Schulungstermine
- Zielvereinbarung - Eine mögliche Form der Ergänzung des Mitarbeitendengesprächs
- Fragen zur Reflexion einer Beratung/einer Besprechung
- Beratungsform: Ablauf, um fundiert und strukturiert zu Entscheidungen zu gelangen
- Meinungsbild: Mitarbeitendenbeteiligung für eine umfassende Entscheidungsbasis
- Fehlerkultur
- Storytelling: Kulturvermittlung durch Geschichten und Begriffe
Wo und wie können die Transformationsmarker denn jetzt eine Rolle spielen?
Die Transformationsmarker können vieles sein ...
- eine Beschreibung des Ausgangspunktes, von dem aus eine Veränderung startet.
- die Beschreibung eines Veränderungspunktes, als Zielpunkt der Veränderung, die angestrebt wird.
- der Beobachtungspunkt, mit dem wir uns unser eigenes Handeln immer wieder messen und zurückmelden.
- der Resonanzpunkt, mit dem uns die Wirkung unseres Handelns auf andere von anderen zurückgemeldet wird.
Häufig gestellte Fragen FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Transformation und Umstrukturierung?
Eine Transformation bezieht sich auf einen grundlegenden Wandel in der Strategie, Kultur und Ausrichtung einer Organisation, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen oder um sich neu zu positionieren. Es handelt sich um eine tiefgreifende Veränderung, die oft mehrere Aspekte einer Organisation betrifft.
Eine Umstrukturierung ist eine Veränderung in der organisatorischen Struktur, wie bspw. die Neuanordnung oder Zuordnung von Abteilungen, Teams und Hierarchien. Umstrukturierungen können ein Bestandteil der Transformation sein.
Eine Transformation ist eine ganzheitliche Veränderung auf strategischer und kultureller Ebene, eine Umstrukturierung ist eine Veränderung der Abläufe und der Organisation.
Wer hat die Transformation beauftragt?
Von August 2019 bis September 2021 wurde im Bistum Limburg das Transformationsprogramm als erster Teil eines größeren Transformationsprozesses durchgeführt. Ziel war es, Kulturwandel im Sinne der Kirchenentwicklung auch im Bischöflichen Ordinariat, der mittleren Ebene / Bezirke und für die Prozesse von Beratung und Entscheidung anzustoßen und die dazu passende Organisation und deren Prozesse aufzustellen. Der Auftrag dazu wurde von Bischof Dr. Georg Bätzing erteilt.
Was passiert eigentlich, wenn nichts passiert?
Die Kirche im Bistum Limburg hat in den letzten Jahren nach außen hin rapide an Bedeutung und nach innen an Bindekraft verloren. „Für wen sind wir als Kirche da?“ stellt sich als zentrale Frage. Um sie beantworten zu können, ist ein Perspektivwechsel erforderlich.
Um zu einer gemeinsamen Perspektive zu kommen und vom Ganzen her zu denken, um interessengeleitetes Denken und Handeln zu überwinden und gemeinsame Verantwortung übernehmen zu können, ist eine gemeinsame Haltung erforderlich. Ziel ist es, den nötigen Kulturwandel anzustoßen und eine Organisation zu gestalten, die dies ermöglicht und fördert. Sie soll vom Nutzer her gedacht und auf fortdauernde Entwicklung angelegt sein, um in einer immer komplexer werdenden, sich ständig verändernden Gesellschaft, handlungsfähig zu bleiben. In der Präambel für das Bischöfliche Ordinariat wird dies als Klammer für künftiges Tun verbindlich festgelegt.
Was wird von mir in der Transformation erwartet?
Es gilt weiterhin die finanzielle Bestandssicherung für alle Mitarbeitenden und die Zusage, dass der Transformationsprozess zu keinen betriebsbedingten Kündigungen führen wird. Das Bistum braucht seine Mitabreitenden, deren Leistungsbereitschaft, deren Innovationskraft und deren konstruktive Mitwirkung, in einer offenen, flexiblen und proaktiven Haltung.
Dies beinhaltet die Bereitschaft zur Veränderung (wo sie notwendig wird), die Bereitschaft zur Anpassung an geänderte Bedingungen und die aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung.
- Informieren Sie sich proaktiv, warten Sie nicht darauf, dass man Ihnen auf Sie individuell zugeschnittene und aufbereitete Informationen zeitgerecht zuleitet - werden Sie proaktiv, bspw. auf den Seiten des Transformationsprozesses.
- Melden Sie Ihre Fragen, Hoffnungen, Anregungen und Befürchtungen zurück, bspw. hier.
- Wirken Sie aktiv mit.
Was kann ich von meinen Vorgesetzten in der Transformation erwarten?
Die Transformationsmarker sehen bspw. Beteiligung, Transparenz und Lernen als Merkmale der Kultur unseres Zusammenwirkens vor.
Wer soll das alles machen?
Wir, die wir im Bistum und für das Bistum tätig sind. Wir werden die Transformation, als Anpassung an eine veränderte Umwelt und in dem Wunsch, als Kirche weiterhin für die Menschen im Bistum relevant zu bleiben, neben unseren "normalen" Tätigkeiten leisten. Dabei schöpfen wir unsere Möglichkeiten so gut es geht aus. Wir setzten uns realisitische Ziele und behalten die Anforderungen unserer Tätigkeit, aber auch unsere körperlichen und privaten Anforderungen im Blick. Niemand sollte über seine Grenzen gehen!
Wenn wir unsere Grenzen sehen oder erreichen, informieren wir unsere Vorgesetzten. Dann muss gemeinsam nach einem fairen und guten Weg gesucht werden.
Für den Fall, dass nichts mehr geht, wurde bereits vor längerer Zeit von der MAV des Bistums der Verfahrensweg einer Überlastungsanzeige beschrieben.

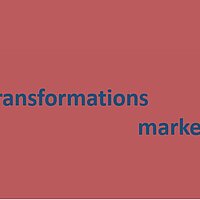


 Bildergalerie
Bildergalerie